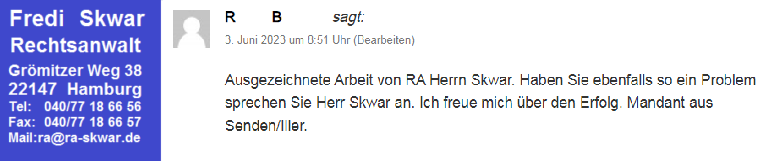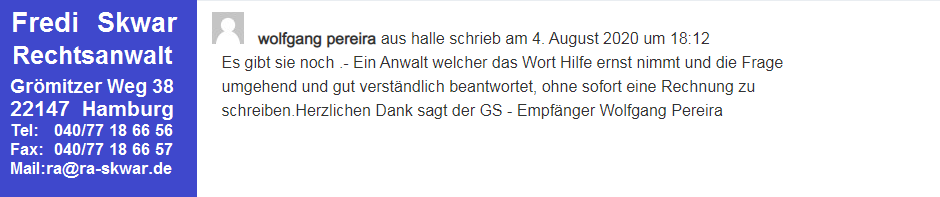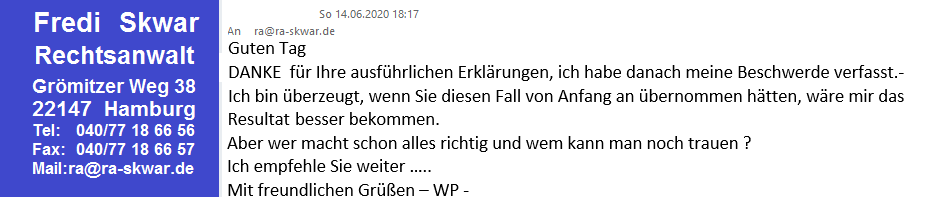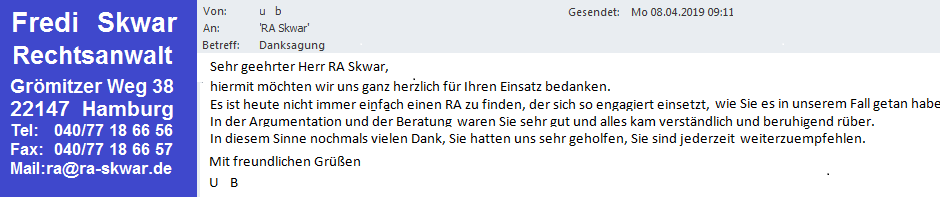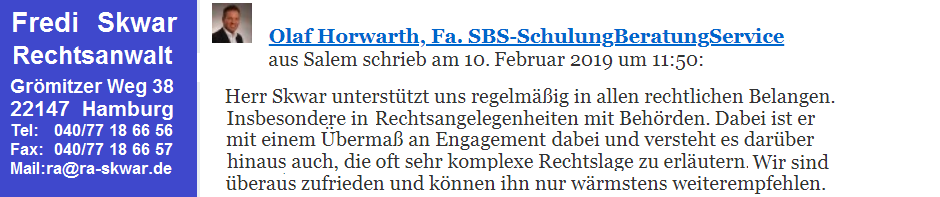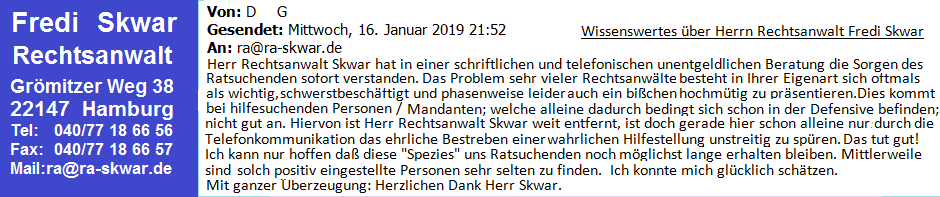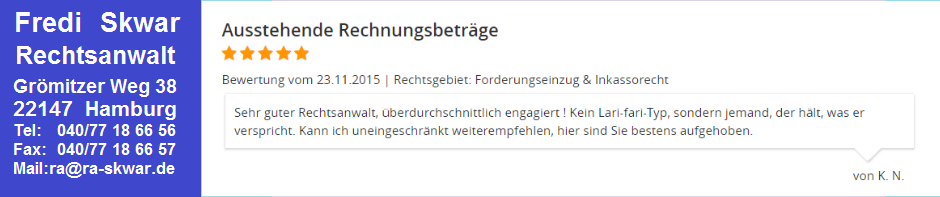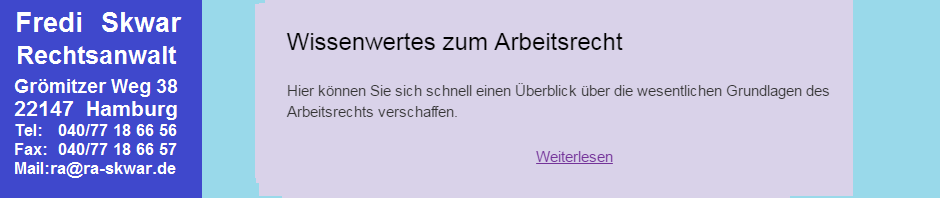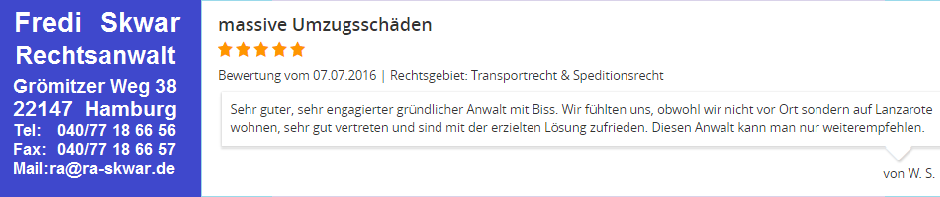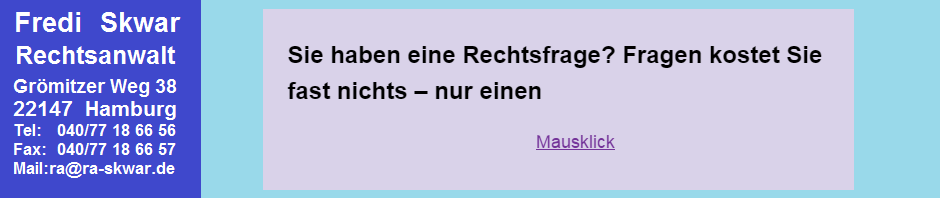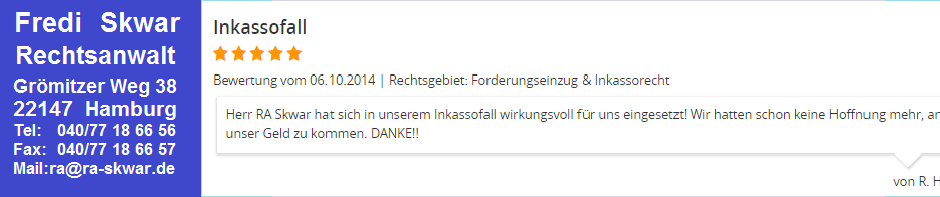OLG München, Urteil vom 15.12.2011 – 1 U 1913/10
Auf einer Intensivstation einer Klinik muß umgehend Personal greifbar sein muss, das lebensbedrohliche Situationen (hier: weitgehende Blockade des Beatmungstubus eines Patienten) kunstgerecht behandeln und abwenden kann (Rn 33). Ist dies nicht der Fall, liegt hierin ein Organisationsverschulden des Klinikbetreibers.
Tenor
I. Auf die Berufung des Klägers hin wird das klageabweisende Urteil des Landgerichts München I vom 16.12.2009 abgeändert.
II. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ein Schmerzensgeld von 300.000,– € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.02.2003 zu zahlen.
III. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche materiellen Schäden aus der Fehlbehandlung vom 04.05.2000 zu ersetzen, soweit dieser Anspruch nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen ist oder noch übergeht.
IV. Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.
V. Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens mit Ausnahme der Kosten der Nebeninterventionen, die der jeweilige Nebenintervenient selbst trägt.
Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens tragen der Kläger zu 6/7 und der Beklagte zu 1/7. Der Kläger trägt die erstinstanzlichen außergerichtlichen Kosten der dortigen Beklagten zu 2) – 7). Die außergerichtlichen erstinstanzlichen Kosten des Klägers trägt der Beklagte zu 1/7. Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen erstinstanzlichen Kosten selbst.
VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Parteien können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, sofern der Vollstreckende nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
VII. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
1
Der Kläger macht gegen den Beklagten Schadensersatzansprüche wegen behaupteter Fehlbehandlung auf dessen chirurgischer Intensivstation in der P.straße in M. geltend.
2
Der am 20.01.1946 geborene Kläger wurde am 27.04.2000 in der Chirurgischen Poliklinik des Beklagten wegen eines Spritzenabszesses operiert. Wegen kardialer Risiken wurde der Kläger nach der Operation vorsorglich auf die Intensivstation des Beklagten in der M.straße in M. verlegt. Nach einer weiteren Operation am 28.04.2000 wurde der Kläger auf die Intensivstation des Beklagten in der P.straße in M. verlegt, wo er in der Folgezeit nasotracheal intubiert maschinell beatmet wurde.
3
Am 04.05.2000 kurz nach 9.00 Uhr verlegte sich der Beatmungstubus teilweise mutmaßlich mit Atemwegssekret. Der Kläger wurde dadurch nicht mehr ausreichend beatmet. Die Vitalparameter (Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck und Herzfrequenz) fielen in der Folgezeit signifikant ab. Zu diesem Zeitpunkt waren auf der Intensivstation die Zeugin Dr. Ko. und der Zeuge Dr. Kr., damals Ärzte im Praktikum, und der Zeuge Dr. S., damals Student in der praktischen Ausbildung, anwesend. Diese entfernten den verlegten Tubus nicht, sondern versuchten, was nicht gelang, den Tubus wieder ausreichend durchgängig zu machen. Sodann versuchten sie, was ebenfalls nicht ausreichend gelang, den Kläger anderweitig ausreichend zu beatmen. Es wurde anschließend der diensthabende Stationsarzt Dr. H., der eine Visite in der N.straße durchführte, per Funk alarmiert. Dr. H. entfernte, nachdem es auch ihm nicht gelungen war, den Tubus wieder ausreichend durchgängig zu machen, diesen und beatmete den Kläger per Maske. Sodann reintubierte Dr. H. den Kläger, entfernte den neuen Tubus wegen Verdachts auf Fehlintubation in die Speiseröhre jedoch wieder und setzte die Maskenbeatmung fort. Gegen 9.22 Uhr reintubierte das herbeigerufene Reanimationsteam den Kläger umgehend erfolgreich.
4
Der Kläger erlitt ein apallisches Wachkoma. Der Kläger, der zuhause gepflegt wird, ist seither nicht ansprechbar. Er kann nicht sprechen und sich nicht bewegen. Eine Verständigung mit ihm ist nicht möglich.
5
Der Kläger hat in erster Instanz vorgebracht, dass er vor dem Eingriff vom 27.04.2000 nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sei.
6
Aus den Röntgenbildern ergäbe sich, dass der Tubus schon seit dem 30.04.2000 nicht mehr richtig gelegen sei. Auf den Abfall der Atemsauerstoffsättigung und des Blutdrucks hin hätte am 04.05.2000 der Tubus sofort entfernt werden müssen. Dem Beklagten fielen auch Organisations- und Dokumentationsmängel zur Last.
7
Der Kläger hat im ersten Rechtszug beantragt:
8
1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ein angemessenes Schmerzensgeld aus der fehlerhaften Behandlung ab April 2000 zu zahlen, dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens 300.000,– € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 01.02.2003.
9
2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche künftigen weiteren immateriellen und alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden, die ihm infolge der fehlerhaften Behandlung ab April 2000 entstanden sind bzw. noch entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind oder noch übergehen werden.
10
Der Beklagte hat beantragt,
11
die Klage abzuweisen.
12
Der Beklagte hat vorgebracht, dass den behandelnden und vorgesetzten Ärzten weder ein Behandlungs- noch ein Organisationsfehler zur Last falle.
13
Das Landgericht hat durch den beauftragten Richter die Wegstrecke zwischen den Intensivstationen in der N.- und in der P.straße in Augenschein genommen. Es hat drei schriftliche intensivmedizinische Gutachten der Sachverständigen Prof. Dr. M. erholt und die Sachverständige am 09.11.2009 angehört.
14
Mit Urteil vom 16.12.2009, dem Klägervertreter zugestellt am 13.01.2010, auf das wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers vom 12.02.2010, die der Kläger nach Fristverlängerung am 15.04.2010 begründet hat. Die Berufung richtet sich lediglich gegen die Klageabweisung in Richtung auf den Beklagten (früheren Beklagten zu 1)). Die Klageabweisung in Richtung auf die früheren Beklagten zu 2) bis 7) nimmt der Kläger hin.
15
Der Kläger bringt vor, Dr. Ko. und Dr. Kr. hätten es grob fehlerhaft unterlassen, den verlegten Tubus sofort zu entfernen und zur Maskenbeatmung überzugehen.
16
Die Behandlungsdokumentation sei unzureichend.
17
Dem Beklagten falle ein Organisationsmangel zur Last. Ärzten in Praktikum habe die Intensivstation nicht eigenverantwortlich anvertraut werden dürfen. Der Beklagte hätte dafür Sorge tragen müssen, dass auf der Intensivstation umgehend ein Arzt zur Verfügung stehe, der eine solche Notfallsituation kunstgerecht behandeln könne.
18
Es sei nicht hinnehmbar, dass zwischen der Verlegung des Tubus und einer suffizienten Reintubation über 20 Minuten vergangen seien.
19
Der Kläger beantragt,
20
den Beklagten unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts München I vom 16.12.2009, Az. 9 O 2206/07, nach den in erster Instanz zuletzt gestellten Anträgen des Klägers zu verurteilen.
21
Der Beklagte und die Nebenintervenienten beantragen,
22
die Berufung des Klägers zurückzuweisen.
23
Sie bringen vor, dass den behandelnden Ärzten einschließlich der beiden Ärzte im Praktikum kein Behandlungsfehler unterlaufen sei.
24
Die Besetzung der Intensivstation habe den Vorschriften entsprochen. Ein Organisationsmangel sei nicht ersichtlich.
25
Die Behandlungsdokumentation sei nicht zu beanstanden.
26
Die vom Kläger behaupteten Behandlungs- und Organisationsfehler seien ohnehin nicht ursächlich für den Gesundheitsschaden, den der Kläger erlitten habe.
27
Der Senat hat am 09.09.2010 die Sachverständige Prof. Dr. M. angehört. Des Weiteren hat der Senat ein schriftliches anästhesiologisch-intensivmedizinisches Obergutachten des Sachverständigen Prof. Dr. R. erholt und am 29.09.2011 den Sachverständigen sowie die Ehefrau und Betreuerin des Klägers angehört und die Zeugen Dr. Ko., Dr. Kr., Dr. S. und Dr. H. vernommen.
28
Im Übrigen wird bezüglich des Parteivorbringens und des Vorbringens der Nebenintervenienten auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.
Entscheidungsgründe
29
Die zulässige Berufung des Klägers ist weitgehend begründet. Dem Beklagten fällt ein grober Organisations- bzw. Behandlungsfehler zur Last.
A.
30
1. Wenn sich der Beatmungstubus teilweise verlegt und, wie hier, in der Folge die Vitalparameter signifikant abfallen, wird der Patient nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Dieser Zustand muss, da, wie der Sachverständige Prof. Dr. R. erläutert hat, das Gehirn nach drei bis fünf Minuten anfängt wegzusterben, dringlichst umgehend behoben werden. Zunächst muss der verlegte Beatmungstubus, wenn dieser, wie hier, nicht kurzfristig wieder durchgängig gemacht werden kann, gezogen werden. Geschieht dies nicht, bleibt es zwangsläufig bei der unzureichenden Sauerstoffzufuhr. Der Tubus wurde jedoch erst von Dr. H. gezogen.
31
Der Senat ist davon überzeugt, dass bis zum Ziehen des Tubus durch Dr. H. mindestens acht Minuten vergangen sind. Die Behandlungsunterlagen, insbesondere auch das Gedächtnisprotokoll vom 04.05.2000, enthalten zwar, was dem Senat schon zu denken gibt, nur recht vereinzelt Zeitangaben. Dennoch lassen die Zeugenaussagen Dr. Ko., Dr. Kr. und Dr. H. in Verbindung mit der Einschätzung des Sachverständigen eine zuverlässige zeitliche Rekonstruktion zu. Der Sachverständige hat in Anbetracht der Ungeübt- und Unerfahrenheit von Dr. Ko. und Dr. Kr. den Zeitbedarf für die von diesen vor der Alarmierung des Stationsarztes durchgeführten Maßnahmen auf vier bis fünf Minuten veranschlagt. Der Senat hält diese Einschätzung für wesentlich fundierter wie die Angabe der Zeugin Dr. Ko., die diesen Zeitraum auf zwei Minuten geschätzt hat. Die Zeugin hat eingeräumt, dass ihr der zeitliche Ablauf nicht mehr so genau in Erinnerung ist. Der Senat muss in seine Erwägung auch einstellen, dass die Zeugin unter dem Aspekt eines Gesamtschuldnerausgleichs gemäß § 426 BGB ein Interesse daran hat, diesen Zeitraum möglichst kurz zu halten. Nach den Aussagen Dr. Ko. und Dr. H. ist dieser drei Minuten nach der Alarmierung eingetroffen. Nach der Aussage Dr. Kr. vergingen, Dr. H. hat zunächst versucht, die Durchgängigkeit des Tubus wiederherzustellen, zwischen dem Erscheinen von Dr. H. und der Extubation zwei weitere Minuten. Dr. H. veranschlagt diesen Zeitraum nur auf etwa 45 Sekunden, die Zeugin Dr. Ko. auf weniger als eine Minute.
32
Dieser Zeitraum von mindestens acht Minuten ist, insbesondere in Anbetracht des nach drei bis fünf Minuten einsetzenden Gehirntodes, viel zu lang. Demzufolge hat Dr. H. den Kläger auch in einem bedrohlichen Zustand – blau, Bradykardie, Herz-Kreislaufstillstand, Bewusstlosigkeit – angetroffen.
33
Der Sachverständige Prof. Dr. R. hat, was auch auf der Hand liegt, erläutert, dass auf einer Intensivstation umgehend Personal greifbar sein muss, das derartige lebensbedrohliche Situationen kunstgerecht behandeln und abwenden kann. Das Problem liegt dabei nicht darin, dass die Extubation als solche schwierig durchzuführen wäre. Die anschließende zuverlässige Reintubation des Patienten mit einem neuen freien Tubus beziehungsweise die Überbrückung der Zwischenzeit mit Maskenbeatmung erfordert jedoch Übung und Erfahrung. Wenn dies nicht gelingt und der Patient auch nicht spontan atmet, ist dieser völlig von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten. Deshalb haben die Zeugen Dr. Ko. und Dr. Kr., die, wie sie bei ihrer Einvernahme am 29.09.2011 angegeben haben, keine nennenswerte Erfahrung mit einem solchen Beatmungsmanagement hatten, sich wohl auch nicht getraut, den (nicht vollständig) verlegten Tubus zu ziehen.
34
Dem Beklagten fällt zur Last, dass es, da auf der Intensivstation nur im Beatmungsmanagement unkundiges Personal anwesend war, mindestens acht Minuten gedauert hat, bis die erforderliche Maßnahme, Entfernung des Tubus, getroffen wurde. Der Senat sieht dies (in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen Professor Dr. R.) als grobes Versäumnis an. Wenn sich der Tubus verlegt, womit man auf einer Intensivstation rechnen muss und deshalb darauf vorbereitet sein kann und muss, geht es, was ebenfalls ex ante offenkundig ist, darum, durch sofortiges kunstgerechtes Eingreifen das Leben des Patienten zu retten beziehungsweise schwerste Gesundheitsschäden von diesem abzuwenden. Die erforderlichen Maßnahmen sind von einem kundigen und geübten Arzt auch regelmäßig erfolgreich und sicher durchführbar. Deshalb und wegen des Risikopotentials für den Patienten darf eine so lange vermeidbare Verzögerung der richtigen Maßnahmen schlichtweg nicht vorkommen. Darauf, ob die Zeugen Dr. Ko. und Dr. Kr., worauf das Landgericht fälschlicherweise abstellt, persönlich ein Vorwurf zu machen ist, kommt es für die Haftung des Beklagten nicht an. Der Beklagte ist gleichermaßen haftpflichtig, wenn, wofür das Ergebnis der Beweisaufnahme spricht, leitende Ärzte keine geeignete organisatorische Vorsorge getroffen haben, um derartige Notfälle auf der Intensivstation zeitgerecht durch einen hinreichend qualifizierten Arzt behandeln zu können (grober Organisationsmangel), wie wenn eine derartige Struktur errichtet und hinreichend kommuniziert war, jedoch von den Zeugen Dr. Ko. und Dr. Kr. wider besseres Wissen und in Kenntnis der Tatsache, dass wegen des hohen Risikos für Leben und Gesundheit des Klägers keine Zeit verloren werden darf, nicht umgesetzt wurde (grobes Individualversagen). In beiden Varianten muss der Beklagte für das Fehlverhalten seiner Mitarbeiter gleichermaßen in vollem Umfang über die § 278 beziehungsweise § 31 BGB einstehen.
35
Die Zeugen Dr. Ko., Dr. Kr. (und auch der Zeuge Dr. S.) haben übereinstimmend angegeben, dass sie seinerzeit über keine nennenswerte Erfahrung im Beatmungsmanagement verfügt haben. Insbesondere waren sie, wie auch der Sachverständige Prof. Dr. R. bestätigt hat, von ihrem Übungs- und Ausbildungsstand her nicht in der Lage, einen Tubus zu ziehen und sodann eigenverantwortlich den Patienten zuverlässig zu beatmen und zu reintubieren.
36
Das Ergebnis der Begutachtung durch Prof. Dr. R. ist, soweit es hier darauf ankommt, mit der Begutachtung durch Frau Prof. Dr. M. problemlos vereinbar. Die Sachverständige hat im Termin vom 09.09.2010 lediglich ein persönliches Verschulden der Zeugen Dr. Ko. und Dr. Kr. im Hinblick darauf verneint, dass es, da diese im Beatmungsmanagement nicht hinreichend ausgebildet und erfahren waren, ihnen persönlich nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie davon abgesehen haben, den Tubus zu ziehen. Sie hat aber auch betont, dass der Königsweg die Entfernung des verlegten Tubus und die Reintubation mit einem neuen Tubus gewesen wäre.
37
2. Mit dem unter Ziffer 1 genannten, dem Beklagten zur Last fallenden groben Versäumnis, ist eine Beweislastumkehr hinsichtlich der Ursächlichkeit dieses Behandlungsfehlers für den gesundheitlichen Primärschaden des Klägers (apallisches Wachkoma) verbunden. Beweiserleichterungen kommen bei groben Organisationsfehlern in gleicher Weise wie bei groben Behandlungsfehlern in Betracht (BGH, Urteil vom 16.04.1996, VI ZR 190/95 = VersR 1996, 976, 979).
38
Der Sachverständige Prof. Dr. R. hat dargelegt, dass, wenn der teilweise verlegte Tubus binnen 3 – 4 Minuten entfernt und der Kläger anderweitig suffizient beatmet worden wäre, der Zwischenfall für den Kläger mit 90 %iger Wahrscheinlichkeit folgenlos geblieben wäre. Der Sachverständige hat darauf hingewiesen, dass, da der Kläger ohnehin nicht mehr so weit von der regulären Extubation entfernt war, eine gute Chance bestanden hatte, dass der Kläger nach der Entfernung des Tubus spontan atmen konnte. Unabhängig davon wäre es jedenfalls möglich gewesen, die Atmung mit einer Atemmaske zu unterstützen oder den Kläger zu reintubieren. Damit steht fest, dass der grobe Fehler, der dem Beklagten zur Last fällt, generell geeignet ist, den streitgegenständlichen gesundheitlichen Primärschaden des Klägers (apallisches Wachkoma) herbeizuführen. Der nunmehr dem Beklagten obliegende Beweis, dass der grobe Behandlungsfehler für den gesundheitlichen Primärschaden des Klägers nicht ursächlich geworden ist, ist bei dieser Sachlage aussichtslos und vom Beklagten auch nicht ansatzweise geführt. Vielmehr könnte der Kläger den Ursachenzusammenhang auf der Basis dieser Einschätzung des Sachverständigen seinerseits beweisen.
39
3. Dem Kläger steht aus § 253 Abs. 2 BGB ein Schmerzensgeld von 300.000,– € zu. Der Kläger ist aufgrund der vom Beklagten verschuldeten Sauerstoffunterversorgung dauerhaft in ein apallisches Wachkoma gefallen. Die Ehefrau und Betreuerin des Klägers, die den Kläger mit Hilfe eines ambulanten Dienstes zu Hause pflegt, hat in der Sitzung vom 29.09.2011 glaubhaft und unwidersprochen angegeben, dass der Kläger nach wie vor nicht ansprechbar ist und selbst nicht sprechen kann. Die Ehefrau des Klägers kann lediglich aus unwillkürlichen Zeichen Rückschlüsse auf das Befinden des Klägers ziehen. Der Kläger kann sich auch nicht bewegen. Der gesundheitliche Dauerschaden, den der Kläger erlitten hat, ist damit im obersten Segment einzuordnen. Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.10.1992 (VI ZR 201/91 = NJW 1993, 781) ist es anerkannt, dass auch schwere Hirnschäden, die weitgehend zum Verlust der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit führen, durch eine Geldentschädigung auszugleichen sind. Der Verlust der Persönlichkeit infolge einer schweren Hirnschädigung stellt unabhängig vom schwerlich objektivierbaren persönlichen Leidensdruck schon für sich genommen einen auszugleichenden immateriellen Schaden dar. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den Umständen, die dem Schaden im Einzelfall sein Gepräge geben. Wenn ein 54-jähriger Mann infolge des Behandlungsmangels seine Persönlichkeit verliert, nicht mehr als bewusstes Individuum weiter existiert und in jeder Hinsicht hilfs- und pflegebedürftig wird, ist ein Schmerzensgeld von 300.000,– € angemessen. Dies entspricht, bezogen auf die statistische Lebenserwartung des Klägers zum Behandlungszeitpunkt, einem monatlichen Schmerzensgeldbetrag von etwa 1.000,– €.
40
Der Senat hat berücksichtigt, dass der Kläger zum Behandlungszeitpunkt an nicht unerheblichen Vorerkrankungen, die geeignet waren, seine Lebensqualität in Zukunft zu beeinträchtigen, gelitten hat.
41
Der Umstand, dass dem Beklagten ein grober Behandlungsfehler zur Last fällt, spielt für die Bemessung des Schmerzensgeldes keine Rolle. Die Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes entfällt, wie der Bundesgerichtshof in der vorgenannten Entscheidung dargelegt hat, wenn bei dem Geschädigten sich infolge des erlittenen Gesundheitsschadens ein Empfinden der Genugtuung durch die Schmerzensgeldzahlung nicht einstellen kann.
42
Dem Senat ist aus anderen Fällen bekannt, dass sich ein apallisches Wachkoma, wenn über 10 Jahre nach dem schädigenden Ereignis keine Besserung eingetreten ist, nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft bis zum Lebensende des Patienten nicht mehr nennenswert ändert.
43
4. Da dem Beklagten ein grober Organisations- beziehungsweise Behandlungsfehler zur Last fällt, war auch dem materiellen Feststellungsantrag des Klägers stattzugeben.
44
Anspruch auf Feststellung der Ersatzpflicht des Beklagten für künftige immaterielle Schäden hat der Kläger dagegen nicht. Der vom Senat zugesprochene Schmerzensgeldbetrag von 300.000 Euro gilt nicht nur die Zerstörung der Persönlichkeit des Klägers für die Vergangenheit, sondern, wie jede Schmerzensgeldzahlung, auch den absehbaren immateriellen Zukunftsschaden ab. Der Senat hat deshalb das zugesprochene Schmerzensgeld von 300.000 Euro, wie erwähnt, auch an der statistischen Lebenserwartung des Klägers zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Behandlung bemessen. Da eine für die Bemessung des Schmerzensgeldes relevante Veränderung im Befinden des Klägers in hohem Maße unwahrscheinlich ist, ist die Möglichkeit des Eintritts eines mit dem zugesprochenen Schmerzensgeld noch nicht abgegoltenen immateriellen Schadens und damit das Feststellungsinteresses des Klägers im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO zu verneinen.
45
5. Die Zinsentscheidung beruht auf §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem mit der Klageschrift vorgelegten Mahnschreiben vom 20.01.2003 (Anlage K 8).
B.
46
1. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1, 100 und 101 ZPO.
47
Es wirkt sich auf die Kostenentscheidung nicht aus, dass der Kläger mit dem immateriellen Feststellungsantrag keinen Erfolg hat (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Der Teilstreitwert für den Feststellungsantrag wurde mit 200.000 Euro bemessen. In Anbetracht des mutmaßlichen hohen materiellen Schadens für die vergangenen nahezu 12 Jahre und dem derzeit noch offenen, aber vermutlich ebenfalls nicht geringen materiellen Zukunftsschaden, entfällt auf den immateriellen Zukunftsschaden ersichtlich nur ein völlig untergeordneter Teilbetrag aus diesen 200.000 Euro.
48
2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
49
3. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO sind nicht gegeben.